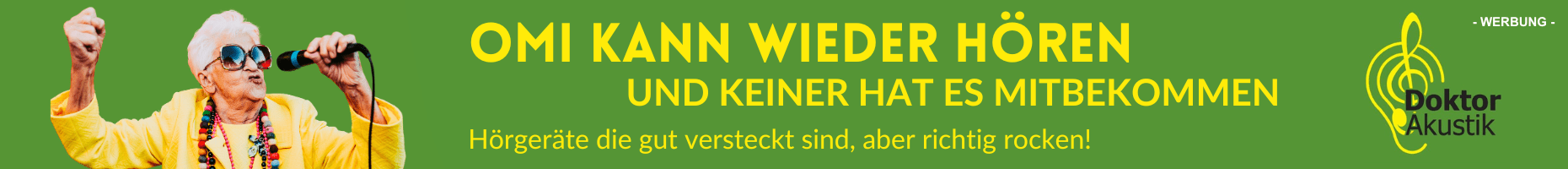Die Stadtverwaltung Radebeul reduziert das „Lügenmuseum“ auf einen temporären Mietkonflikt – und ignoriert damit eine Institution, die weit mehr ist als eine Zwischennutzung. Der Oberbürgermeister beschreibt das Projekt als provisorisches Einlagerungsmuseum, was der über 30‑jährigen Kulturarbeit in keiner Weise gerecht wird. Hinweis auf politische Verantwortung? Keine Spur: Stattdessen ein neoliberales Verwaltungserzählmuster ohne Bezug zur künstlerischen Vision und erinnerungspolitischen Relevanz.
Der Beitrag des Lügenmuseums bleibt ungewürdigt: demokratische Selbstreflexion, Transformationskunst, Erinnerung und kritische Gegenwartskunst – all das verschwindet in der Sprache von Bauten, Mietverträgen und Verkehrswerten. Der öffentliche Diskurs darüber, wie Erinnerung lebendig gehalten wird, fehlt weitgehend. Ebenso verweigert die Stadt jeglichen Dialog über alternative Trägerlösungen oder Stiftungslösungen. Das Schreiben entbehrt jeglicher Empathie für die prekäre Situation des Projekts, das mit Fördermitteln von rund 500.000 € aufgebaut wurde.
Statt dem Lügenmuseum eine Perspektive zu geben, werden alle Schuldzuweisungen – vom Verkauf über Sanierungskosten bis zur Kommunikation – dem Betreiber angelastet. Die strukturellen Rahmenbedingungen für freie Kunstproduktion bleiben unerwähnt. Damit verstärkt die Kommune nicht nur ein narratives Ungleichgewicht, sondern gefährdet eine kulturelle Selbstkritik, die besonders in Zeiten wachsender Geschichtsvergessenheit dringend notwendig ist.
Das Lügenmuseum ist kein Lager – es ist gelebte Aufarbeitung durch Kunst, und das wird aus rein immobilienorientierten Verwaltungslogiken gänzlich ausgeklammert.